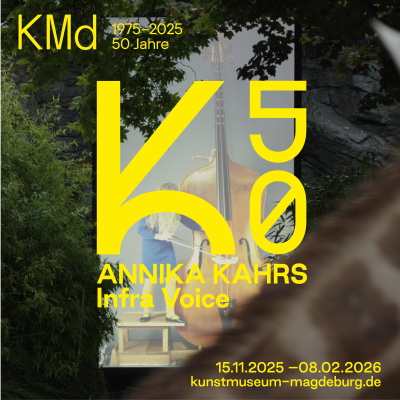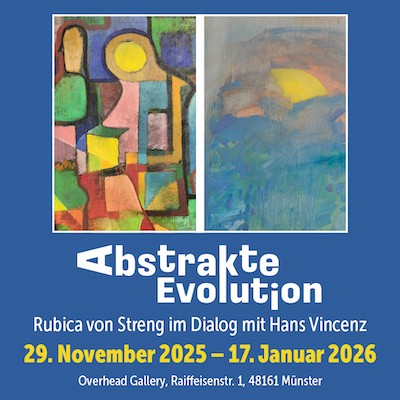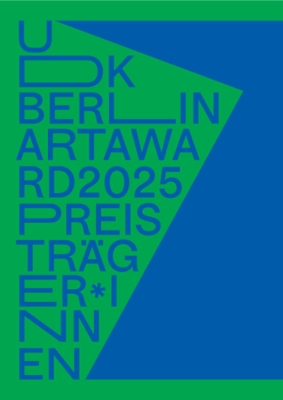Das nächste Readymade? Wie Kunst auf KI und die virtuelle Flut reagiert
Eingabedatum: 12.06.2025
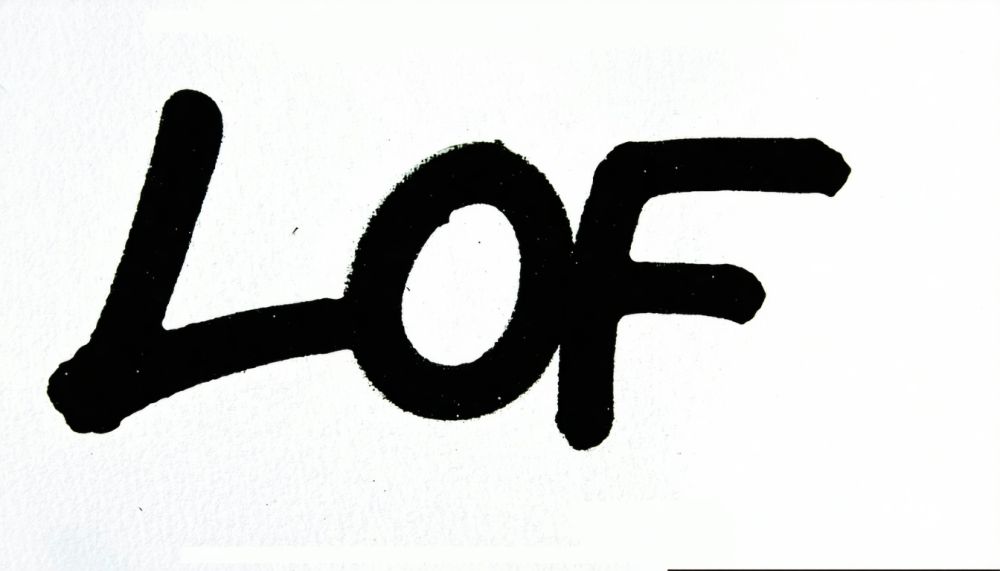
Vor über einem Jahrhundert stellte Marcel Duchamp mit einem Pissoir die Kunstwelt auf den Kopf. Seine Readymades waren eine radikale Antwort auf das Zeitalter der Industrialisierung. Heute, im Angesicht von Künstlicher Intelligenz und der unaufhaltsamen Virtualisierung unserer Lebenswelten, stehen Künstler vor einer ähnlich disruptiven Welle. Welche Formen nimmt das "nächste Readymade" an, und wie reagiert die Kunst auf die Algorithmen und Avatare, die unsere Realität neu definieren?
Erinnern wir uns: Als Marcel Duchamp 1917 ein handelsübliches Urinal unter dem Titel "Fountain" zur Ausstellung einreichte, war das mehr als eine bloße Provokation. Es war ein tiefgreifender Kommentar zur industriellen Massenproduktion, die den Kult des handgefertigten Originals und die traditionelle Rolle des Künstlers als genialer Handwerker in Frage stellte. Duchamp demonstrierte, dass der künstlerische Akt primär in der Idee, in der Auswahl und der konzeptuellen Rahmung liegen kann – nicht zwingend in der manuellen Fertigung. Das Readymade entmystifizierte das Kunstobjekt und lenkte den Blick auf die Mechanismen des Kunstbetriebs selbst. Es war die adäquate künstlerische Geste für eine Welt, die zunehmend von Maschinen und standardisierten Prozessen geprägt wurde.
Die "vorgefundenen Objekte" unserer Zeit sind nicht mehr nur physische Massenprodukte. Es sind Datensätze, Code-Schnipsel, KI-generierte Bilder und Texte, ja sogar die Algorithmen selbst. Künstler beginnen, diese digitalen Artefakte als "Digital Readymades" zu appropriieren:
Daten als Rohstoff: Künstler wie Refik Anadol oder Trevor Paglen nutzen riesige Datensätze, um die verborgenen Muster und Machtstrukturen unserer datengesteuerten Gesellschaft sichtbar zu machen. Die Auswahl und Visualisierung dieser Daten wird zur künstlerischen Geste.
Algorithmische Autorschaft? Wenn eine KI ein Gedicht schreibt oder ein Bild malt – wer ist der Künstler? Der Programmierer? Der Nutzer, der den "Prompt" formuliert? Oder die KI selbst? Projekte, die mit generativen Modellen (wie GANs oder Textgeneratoren) arbeiten, loten diese neuen Grenzen der Autorschaft aus und hinterfragen spielerisch oder kritisch die menschliche Monopolstellung auf Kreativität. Mario Klingemann oder Hito Steyerl setzen sich in ihren Werken oft kritisch mit diesen Technologien auseinander.
Kritik der digitalen Macht: So wie Duchamp die Institution Kunst herausforderte, untersuchen zeitgenössische Künstler die neuen Machtzentren der Tech-Konzerne, die "Black Boxes" der Algorithmen und die in ihnen eingeschriebenen Biases und Vorurteile.
Immersive Welten als neue Leinwand: Künstler wie Olafur Eliasson oder Marina Abramović experimentieren mit VR, um immersive Erfahrungen zu schaffen, die physisch unmöglich wären. Der Betrachter wird zum Teilnehmer, der nicht mehr vor, sondern in dem Werk agiert. Die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Realität und Simulation verschwimmen.
Das "Virtuelle Readymade": Digitale Assets aus Computerspielen, Avatare oder vorgefertigte 3D-Modelle können, ähnlich Duchamps Alltagsgegenständen, aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und in neue künstlerische Narrative überführt werden. Die Ästhetik der Simulation, die Glitches und die spezifischen visuellen Sprachen virtueller Welten werden selbst zum Material.
Neue Präsenz und Identität: Avatare ermöglichen es Künstlern (und Betrachtern), mit multiplen Identitäten zu experimentieren und neue Formen der Selbstdarstellung und sozialen Interaktion im virtuellen Raum zu erforschen. Die Frage nach dem "echten" Körper und der "authentischen" Erfahrung wird neu verhandelt. Künstlerische Performances finden zunehmend in virtuellen Umgebungen statt, die eine globale Teilhabe ermöglichen.
Die Ökonomie des Virtuellen: Mit NFTs (Non-Fungible Tokens) hat sich ein neuer Markt für digitale Kunst entwickelt, der Fragen nach Originalität, Besitz und Wert im immateriellen Raum aufwirft – eine Debatte, die Duchamp mit seiner Infragestellung des Warencharakters von Kunst vorweggenommen haben könnte. Gleichzeitig wird die Zugänglichkeit und die ökologische Nachhaltigkeit dieser Systeme kritisch diskutiert.
Sie thematisieren die Gefahr des Eskapismus und der Entfremdung in hyperrealen Simulationen.
Sie legen die Überwachungsmechanismen und die kommerziellen Interessen offen, die virtuellen Plattformen oft zugrunde liegen.
Sie hinterfragen die Ästhetik des Perfekten und Glatten, die KI-generierten Inhalten oft anhaftet, und suchen nach Brüchen, Fehlern und dem Unvorhergesehenen.
Sie erforschen die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer zunehmend virtualisierten Existenz.
Vielleicht liegt eine der stärksten Reaktionen auch in einer Art "digitaler Askese" oder einer subversiven Nutzung – dem bewussten Verzicht, der Reduktion oder der ironischen Umkehrung der technologischen Möglichkeiten, um deren Allgegenwart und Wirkmacht umso deutlicher zu machen.
Ob physisches Objekt, Codezeile oder virtueller Raum – die Kunst behält ihre Funktion als Seismograph gesellschaftlicher Veränderungen. So wie Duchamps Readymades uns zwangen, neu über Kunst und ihre Rolle in einer industrialisierten Welt nachzudenken, fordern uns zeitgenössische Künstler heraus, die Implikationen einer von Algorithmen und Avataren geprägten Zukunft zu durchdringen. Das "nächste Readymade" ist vielleicht weniger ein einzelnes Objekt als vielmehr eine Haltung: die Bereitschaft, die Werkzeuge unserer Zeit nicht nur zu benutzen, sondern sie kritisch zu sezieren und die wirklich wichtigen Fragen zu stellen – nach dem, was uns als Menschen in einer zunehmend künstlichen Welt ausmacht. Die Antworten darauf werden so vielfältig und überraschend sein wie die Kunst selbst.
Die Grenzen dessen, was als Kunst gilt, verschieben sich. Die Auseinandersetzung mit KI und digitalen Technologien in der Kunst führt zu neuen ästhetischen und konzeptuellen Ansätzen.
Erinnern wir uns: Als Marcel Duchamp 1917 ein handelsübliches Urinal unter dem Titel "Fountain" zur Ausstellung einreichte, war das mehr als eine bloße Provokation. Es war ein tiefgreifender Kommentar zur industriellen Massenproduktion, die den Kult des handgefertigten Originals und die traditionelle Rolle des Künstlers als genialer Handwerker in Frage stellte. Duchamp demonstrierte, dass der künstlerische Akt primär in der Idee, in der Auswahl und der konzeptuellen Rahmung liegen kann – nicht zwingend in der manuellen Fertigung. Das Readymade entmystifizierte das Kunstobjekt und lenkte den Blick auf die Mechanismen des Kunstbetriebs selbst. Es war die adäquate künstlerische Geste für eine Welt, die zunehmend von Maschinen und standardisierten Prozessen geprägt wurde.
Das digitale Zeitalter: Auf der Suche nach dem neuen "Vorgefundenen"
Springen wir ins 21. Jahrhundert. Die Fabrikhallen von einst sind den Serverfarmen gewichen, die Fließbänder den Algorithmen. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) durchdringen alle Lebensbereiche und stellen uns vor neue Fragen zu Kreativität, Autorschaft und dem, was wir als "real" betrachten. Wenn Duchamps Readymades eine Reaktion auf die Industrialisierung waren, was sind dann die künstlerischen Antworten auf unsere algorithmisch kuratierte und zunehmend virtualisierte Gegenwart?Die "vorgefundenen Objekte" unserer Zeit sind nicht mehr nur physische Massenprodukte. Es sind Datensätze, Code-Schnipsel, KI-generierte Bilder und Texte, ja sogar die Algorithmen selbst. Künstler beginnen, diese digitalen Artefakte als "Digital Readymades" zu appropriieren:
Daten als Rohstoff: Künstler wie Refik Anadol oder Trevor Paglen nutzen riesige Datensätze, um die verborgenen Muster und Machtstrukturen unserer datengesteuerten Gesellschaft sichtbar zu machen. Die Auswahl und Visualisierung dieser Daten wird zur künstlerischen Geste.
Algorithmische Autorschaft? Wenn eine KI ein Gedicht schreibt oder ein Bild malt – wer ist der Künstler? Der Programmierer? Der Nutzer, der den "Prompt" formuliert? Oder die KI selbst? Projekte, die mit generativen Modellen (wie GANs oder Textgeneratoren) arbeiten, loten diese neuen Grenzen der Autorschaft aus und hinterfragen spielerisch oder kritisch die menschliche Monopolstellung auf Kreativität. Mario Klingemann oder Hito Steyerl setzen sich in ihren Werken oft kritisch mit diesen Technologien auseinander.
Kritik der digitalen Macht: So wie Duchamp die Institution Kunst herausforderte, untersuchen zeitgenössische Künstler die neuen Machtzentren der Tech-Konzerne, die "Black Boxes" der Algorithmen und die in ihnen eingeschriebenen Biases und Vorurteile.
Virtualisierung: Die Entgrenzung des Kunstraums
Eine der radikalsten Entwicklungen ist zweifellos die Virtualisierung. Virtuelle Realität (VR), Erweiterte Realität (AR) und die aufkeimenden Metaversen erweitern den Kunstbegriff und den Ort der Kunsterfahrung fundamental:Immersive Welten als neue Leinwand: Künstler wie Olafur Eliasson oder Marina Abramović experimentieren mit VR, um immersive Erfahrungen zu schaffen, die physisch unmöglich wären. Der Betrachter wird zum Teilnehmer, der nicht mehr vor, sondern in dem Werk agiert. Die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Realität und Simulation verschwimmen.
Das "Virtuelle Readymade": Digitale Assets aus Computerspielen, Avatare oder vorgefertigte 3D-Modelle können, ähnlich Duchamps Alltagsgegenständen, aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und in neue künstlerische Narrative überführt werden. Die Ästhetik der Simulation, die Glitches und die spezifischen visuellen Sprachen virtueller Welten werden selbst zum Material.
Neue Präsenz und Identität: Avatare ermöglichen es Künstlern (und Betrachtern), mit multiplen Identitäten zu experimentieren und neue Formen der Selbstdarstellung und sozialen Interaktion im virtuellen Raum zu erforschen. Die Frage nach dem "echten" Körper und der "authentischen" Erfahrung wird neu verhandelt. Künstlerische Performances finden zunehmend in virtuellen Umgebungen statt, die eine globale Teilhabe ermöglichen.
Die Ökonomie des Virtuellen: Mit NFTs (Non-Fungible Tokens) hat sich ein neuer Markt für digitale Kunst entwickelt, der Fragen nach Originalität, Besitz und Wert im immateriellen Raum aufwirft – eine Debatte, die Duchamp mit seiner Infragestellung des Warencharakters von Kunst vorweggenommen haben könnte. Gleichzeitig wird die Zugänglichkeit und die ökologische Nachhaltigkeit dieser Systeme kritisch diskutiert.
Mehr als nur digitale Spielerei: Die kritische Dimension
Doch eine "adäquate" Reaktion auf diese Umwälzungen erschöpft sich nicht in der bloßen Anwendung neuer Technologien. Im Geiste Duchamps geht es vor allem um die kritische Reflexion. Künstler sind nicht nur Nutzer, sondern auch Hinterfrager dieser neuen digitalen und virtuellen Werkzeuge:Sie thematisieren die Gefahr des Eskapismus und der Entfremdung in hyperrealen Simulationen.
Sie legen die Überwachungsmechanismen und die kommerziellen Interessen offen, die virtuellen Plattformen oft zugrunde liegen.
Sie hinterfragen die Ästhetik des Perfekten und Glatten, die KI-generierten Inhalten oft anhaftet, und suchen nach Brüchen, Fehlern und dem Unvorhergesehenen.
Sie erforschen die psychologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer zunehmend virtualisierten Existenz.
Vielleicht liegt eine der stärksten Reaktionen auch in einer Art "digitaler Askese" oder einer subversiven Nutzung – dem bewussten Verzicht, der Reduktion oder der ironischen Umkehrung der technologischen Möglichkeiten, um deren Allgegenwart und Wirkmacht umso deutlicher zu machen.
Die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen
Ob physisches Objekt, Codezeile oder virtueller Raum – die Kunst behält ihre Funktion als Seismograph gesellschaftlicher Veränderungen. So wie Duchamps Readymades uns zwangen, neu über Kunst und ihre Rolle in einer industrialisierten Welt nachzudenken, fordern uns zeitgenössische Künstler heraus, die Implikationen einer von Algorithmen und Avataren geprägten Zukunft zu durchdringen. Das "nächste Readymade" ist vielleicht weniger ein einzelnes Objekt als vielmehr eine Haltung: die Bereitschaft, die Werkzeuge unserer Zeit nicht nur zu benutzen, sondern sie kritisch zu sezieren und die wirklich wichtigen Fragen zu stellen – nach dem, was uns als Menschen in einer zunehmend künstlichen Welt ausmacht. Die Antworten darauf werden so vielfältig und überraschend sein wie die Kunst selbst.
Die Grenzen dessen, was als Kunst gilt, verschieben sich. Die Auseinandersetzung mit KI und digitalen Technologien in der Kunst führt zu neuen ästhetischen und konzeptuellen Ansätzen.
ct