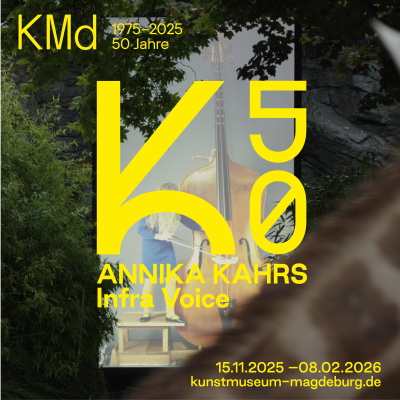Kunst / Geschichten
26. 07 - 26. 10 2014 | Mönchsberg & Rupertinum, Museum der Moderne Salzburg
Eingabedatum: 29.07.2014

In der beide Häuser umfassenden Ausstellung Kunst/Geschichten präsentiert das Museum der Moderne Salzburg anhand von 230 Werken von rund vierzig Künstlern und Künstlerinnen neue und vielfältige Sichtweisen auf Geschichte und historische Ereignisse.
In ihrer ersten Themenausstellung eröffnet Sabine Breitwieser als neue Direktorin des Museum der Moderne Salzburg und Kuratorin dieser Ausstellung eine Diskussion über eine der zentralen Aufgaben des Museums:
die Konstituierung von Geschichte anhand von Artefakten. Dabei richtet sich der Blick über den Bereich der Kunstgeschichte hinaus und setzt den Fokus auf Werke mit einem spezifischen Bezugsrahmen, nämlich auf Kunst, die Geschichte und zeitgeschichtliche Ereignisse sowie ihr eigenes Involviertsein in diesem Prozess des Geschichteschreibens reflektiert. Die Ausstellung umfasst mehr als 230 Werke vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart in einer Vielzahl von Medien, die von Druckgrafik, Zeichnung und Malerei über Fotografie, Film und Video bis zu Installationen und Textilarbeiten reichen. Rund vierzig Künstlerinnen und Künstler aus neunzehn Ländern nehmen an dieser Schau teil, die sich über beide Häuser – Mönchsberg und Rupertinum – erstreckt. Die Ausstellungsräume im Rupertinum präsentieren sich zu diesem Anlass mit einem neu erschlossenen Rundgang im 1. Geschoss.
„In den letzten Jahren wurden vermehrt Fragen aufgeworfen, wie Geschichte verfasst wird, wem diese Aufgabe zukommt und mit welchen Mitteln historische Ereignisse untersucht, evaluiert und letztlich vermittelt werden“, legt Sabine Breitwieser die Aktualität ihrer Themenwahl dar. „Gleichzeitig findet eine Diskussion über die Objektivität von wissenschaftlicher Forschung und Authentizität von historischen Dokumenten, auf denen Geschichtsschreibung basiert, statt. Bildende Künstlerinnen und Künstler haben sich zunehmend Arbeitsweisen angeeignet, die auf Recherche in Archiven, aber auch auf Feldforschung oder Interviews mit
Zeitzeugen basiert. Diese künstlerische Forschungsarbeit wirft Fragen nach ihrem Stellenwert im Vergleich zu wissenschaftlich anerkannten Forschungsergebnissen auf. Wie sollen wir Erzählungen und Neuverfassungen von Geschichte, in denen sich bildende Künstlerinnen und Künstler historischen Themen und zeitgeschichtlichen Ereignissen mit ihren (poetischen) Mitteln und eigens entwickelten Methoden widmen, bewerten?“
In der Schau werden Werke aus hauseigenen und lokalen Sammlungen, prominente Leihgaben namhafter Künstlerinnen und Künstler und neue Produktionen präsentiert. Unterschiedliche Sichtweisen und ebenso unterschiedliche künstlerische Arbeitsweisen, die Gesetzmäßigkeiten des Kunstbetriebs mit eingeschlossen, kommen hier ins Spiel mit Geschichte. Die Ausstellung präsentiert somit geschichtlich engagierte Kunst und Kunstschaffende in einem größeren historischen Rahmen; sie blickt auf aktuelle Ausformungen ebenso wie zurück auf ihre Ursprünge.
Die Ausstellung nimmt ihren Ausgang mit einem gleichermaßen lokalen wie weltbedeutenden Ereignis: der Vertreibung der Protestanten aus Salzburg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die in zahlreichen Kupferstichen erzählt wird. Zu Beginn der Ausstellung am Mönchsberg demonstrieren zwei großräumige Werke zwei mögliche Enden des gesponnenen Fadens von Kunst/Geschichten: Zum einen ist das die Standardbiografie des Konzeptkünstlers Lawrence Weiner, die sich auf beiden Seiten des Treppenhauses als monumentale Installation erstreckt und daran erinnert, wie verstrickt Geschichte mit dem Persönlichen, Biografischen ist. Zum anderen ist das im Jahr 1975 entstandene fantastische Werk des belgischen Künstlers Marcel Broodthaers mit dem Titel Décor: A Conquest by Marcel Broodthaers (Décor: eine Eroberung von Marcel Broodthaers), in der uns zwei ‚Period Rooms‘ des 19. und 20. Jahrhunderts Geschichte schlichtweg als Filmset präsentieren.
In Verbindung mit den bereits erwähnten Emigrationsstichen nehmen künstlerische Medien, die eine große Verbreitung erlauben, eine wichtige Rolle in der Ausstellung ein. Druckgrafik aus der hauseigenen Sammlung von Käthe Kollwitz, die die frühindustriellen Unruhen in ihrem bekannten Zyklus Ein Weberaufstand (1897) festhielt, und von Otto Dix, der die Gräuel des Ersten Weltkriegs in seiner fünfzigteiligen Reihe Der Krieg (1924) verarbeitete, sind nach langer Zeit wieder im Museum zu sehen. Ähnlichen Stellenwert hat die Fotografie als dokumentarisches Medium. Ernst Haas’ Serie Wien nach 1945 (1946–48) mit den berühmten Fotos der Kriegsheimkehrer ist Aufnahmen der aus dem Exil zurückgekehrten Gerti Deutsch und ihrer Sicht auf Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg gegenübergestellt. Kurt Kaindl geht Ende der 1980er-Jahre der Geschichte der emigrierten Salzburger Protestanten, den Georgia Salzburgers. New Ebenezer on the Savannah River (Die Georgia-Salzburger. New Ebenezer am Fluss Savannah) nach.
Die Ausstellung führt über weitere „Kunstgeschichten“ in verschiedene Konflikte in der Welt. „Neuer Krieg – Neue Kunst“ ist auf einem Gemälde aus dem Jahr 1974 von Jörg Immendorff und Felix Droese in der Sammlung des Museums zu lesen. Tatsächlich funktioniert die aktuelle Kunstproduktion aus Krisenregionen in zahlreichen Überblicksschauen der vergangenen Jahre wie ein Arsenal eines auf den Nachschub von neuer Kunst hungrigen Kunstbetriebes. Künstler aus dem Deutschland der Nachkriegszeit wie Anselm Kiefer und Jörg Immendorff gehen in ihren Bildwerken der Vergangenheit ihres Landes nach.
Martha Rosler macht uns in ihrer bekannten Serie mit Fotocollagen Bringing the War Home (1967–72 und 2004–08) deutlich, wie wir Krieg über die Massenmedien täglich ins Wohnzimmer geholt bekommen. In seiner Videoinstallation Klatsassin (2006) führt uns Stan Douglas eine Geschichte ohne Anfang und Ende, dafür aber mit schier endlosen Variationen vor. Elaine Reichek greift in einer Werkserie buchstäblich Ariadnes Faden auf und erkundet diese Geschichte in all ihren widersprüchlichen Phasen und Details in Form von gestickten Bildern. Auch Sanja Ivekovic setzt auf das Wiederaufführen von Geschichte und geschichtlichen Ereignissen, wobei sie sich medialer und performativer Mittel bedient. Alice Creischer und Andreas Siekmann schreiben in ihren großräumigen Installationen eine Geschichte der Wirtschaftsmodelle und der Privatisierung des öffentlichen Raums.
Installationen von Heimrad Bäcker und Ian Hamilton Finlay im Atrium des Rupertinum verbinden Erinnerungsarbeit mit Material und Symbolen; ähnlich inszeniert Renée Green einen Raum im kolonialen Empirestil. Im Rupertinum schließen Harun Farocki, Omer Fast und Walid Raad in ihren Arbeiten mit bild- und medienanalytischen Betrachtungsweisen an. Kader Attia, Lothar Baumgarten, Andrea Geyer, Deimantas Narkevicius, Chen Shaoxiong und Akram Zaatari bedienen sich historischer Archive und Sammlungen, die von ihnen in verschiedenster Weise neu aufgeführt werden. Attia suchte für seine Installation Enteignung (2013) ethnologische Sammlungen in kirchlichen Einrichtungen auf, unter anderem das Missionshaus Maria Sorg in Bergheim bei Salzburg. Anri Sala und Danh Vo (dessen Installation am Mönchsberg zu sehen ist) führen anhand biografischer Kontexte die Vielschichtigkeit der Konstruktion von Geschichte vor. Künstler wie Wael Shawky beleuchten Geschichte aus einem anderen Blickwinkel als dem abendländischen: In Kabarett Kreuzzüge: Die Horrorshow-Akte (2010) stellt er die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber mit den berühmten Lupi-Marionetten ausItalien nach. Gülsün Karamustafa führt uns in ihrer Videoinstallation Memory of a Square (Erinnerung an einen Platz, 2005) durch eine Geschichte des Taksim-Platzes in ihrer Heimatstadt Istanbul.
Die parallel auf dem Mönchsberg gezeigte Werkschau Simone Forti. Mit dem Körper denken: Eine Retrospektive in Bewegung (18. Juli – 9. November 2014) bildet mit den News Animations von Forti die Brücke zur Ausstellung Kunst/Geschichten. Die Künstlerin, Choreografin, Tänzerin und Schriftstellerin Simone Forti befasst sich in ihren News Animations mit der Frage, wie aktuelle Ereignisse im Tanz gespiegelt werden können.
Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung: anonym, Kader Attia, Elias Baeck, Lothar Baumgarten, Alfred Baumgartner, Heimrad Bäcker, Michael Blum, Marcel Broodthaers, Johann August Corvinus, Alice Creischer, Gerti Deutsch, Otto Dix, Stan Douglas, Harun Farocki, Omer Fast, Ian Hamilton Finlay, Simone Forti, Andrea Fraser, Andrea Geyer, Dan Graham, Renée Green, Ernst Haas, Jörg Immendorff / Felix Dröse, Jörg Immendorff, Sanja Ivekovic, Kurt Kaindl, Gülsün Karamustafa, Anselm Kiefer, Käthe Kollwitz, Christoph Lederwasch, Deimantas Narkevicius, Walid Raad / The Atlas Group, Elaine Reichek, Aura Rosenberg, Martha Rosler, Anri Sala, Andreas Siekmann, Wael Shawky, Chen Shaoxiong, Johann Conrad Stapff, Danh Vo, Lawrence Weiner, Akram Zaatari
Museum der Moderne Salzburg
Mönchsberg 32
5020 Salzburg, Austria
T +43 662 842220-403
info@mdmsalzburg.at
museumdermoderne.at
In ihrer ersten Themenausstellung eröffnet Sabine Breitwieser als neue Direktorin des Museum der Moderne Salzburg und Kuratorin dieser Ausstellung eine Diskussion über eine der zentralen Aufgaben des Museums:
die Konstituierung von Geschichte anhand von Artefakten. Dabei richtet sich der Blick über den Bereich der Kunstgeschichte hinaus und setzt den Fokus auf Werke mit einem spezifischen Bezugsrahmen, nämlich auf Kunst, die Geschichte und zeitgeschichtliche Ereignisse sowie ihr eigenes Involviertsein in diesem Prozess des Geschichteschreibens reflektiert. Die Ausstellung umfasst mehr als 230 Werke vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart in einer Vielzahl von Medien, die von Druckgrafik, Zeichnung und Malerei über Fotografie, Film und Video bis zu Installationen und Textilarbeiten reichen. Rund vierzig Künstlerinnen und Künstler aus neunzehn Ländern nehmen an dieser Schau teil, die sich über beide Häuser – Mönchsberg und Rupertinum – erstreckt. Die Ausstellungsräume im Rupertinum präsentieren sich zu diesem Anlass mit einem neu erschlossenen Rundgang im 1. Geschoss.
„In den letzten Jahren wurden vermehrt Fragen aufgeworfen, wie Geschichte verfasst wird, wem diese Aufgabe zukommt und mit welchen Mitteln historische Ereignisse untersucht, evaluiert und letztlich vermittelt werden“, legt Sabine Breitwieser die Aktualität ihrer Themenwahl dar. „Gleichzeitig findet eine Diskussion über die Objektivität von wissenschaftlicher Forschung und Authentizität von historischen Dokumenten, auf denen Geschichtsschreibung basiert, statt. Bildende Künstlerinnen und Künstler haben sich zunehmend Arbeitsweisen angeeignet, die auf Recherche in Archiven, aber auch auf Feldforschung oder Interviews mit
Zeitzeugen basiert. Diese künstlerische Forschungsarbeit wirft Fragen nach ihrem Stellenwert im Vergleich zu wissenschaftlich anerkannten Forschungsergebnissen auf. Wie sollen wir Erzählungen und Neuverfassungen von Geschichte, in denen sich bildende Künstlerinnen und Künstler historischen Themen und zeitgeschichtlichen Ereignissen mit ihren (poetischen) Mitteln und eigens entwickelten Methoden widmen, bewerten?“
In der Schau werden Werke aus hauseigenen und lokalen Sammlungen, prominente Leihgaben namhafter Künstlerinnen und Künstler und neue Produktionen präsentiert. Unterschiedliche Sichtweisen und ebenso unterschiedliche künstlerische Arbeitsweisen, die Gesetzmäßigkeiten des Kunstbetriebs mit eingeschlossen, kommen hier ins Spiel mit Geschichte. Die Ausstellung präsentiert somit geschichtlich engagierte Kunst und Kunstschaffende in einem größeren historischen Rahmen; sie blickt auf aktuelle Ausformungen ebenso wie zurück auf ihre Ursprünge.
Die Ausstellung nimmt ihren Ausgang mit einem gleichermaßen lokalen wie weltbedeutenden Ereignis: der Vertreibung der Protestanten aus Salzburg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die in zahlreichen Kupferstichen erzählt wird. Zu Beginn der Ausstellung am Mönchsberg demonstrieren zwei großräumige Werke zwei mögliche Enden des gesponnenen Fadens von Kunst/Geschichten: Zum einen ist das die Standardbiografie des Konzeptkünstlers Lawrence Weiner, die sich auf beiden Seiten des Treppenhauses als monumentale Installation erstreckt und daran erinnert, wie verstrickt Geschichte mit dem Persönlichen, Biografischen ist. Zum anderen ist das im Jahr 1975 entstandene fantastische Werk des belgischen Künstlers Marcel Broodthaers mit dem Titel Décor: A Conquest by Marcel Broodthaers (Décor: eine Eroberung von Marcel Broodthaers), in der uns zwei ‚Period Rooms‘ des 19. und 20. Jahrhunderts Geschichte schlichtweg als Filmset präsentieren.
In Verbindung mit den bereits erwähnten Emigrationsstichen nehmen künstlerische Medien, die eine große Verbreitung erlauben, eine wichtige Rolle in der Ausstellung ein. Druckgrafik aus der hauseigenen Sammlung von Käthe Kollwitz, die die frühindustriellen Unruhen in ihrem bekannten Zyklus Ein Weberaufstand (1897) festhielt, und von Otto Dix, der die Gräuel des Ersten Weltkriegs in seiner fünfzigteiligen Reihe Der Krieg (1924) verarbeitete, sind nach langer Zeit wieder im Museum zu sehen. Ähnlichen Stellenwert hat die Fotografie als dokumentarisches Medium. Ernst Haas’ Serie Wien nach 1945 (1946–48) mit den berühmten Fotos der Kriegsheimkehrer ist Aufnahmen der aus dem Exil zurückgekehrten Gerti Deutsch und ihrer Sicht auf Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg gegenübergestellt. Kurt Kaindl geht Ende der 1980er-Jahre der Geschichte der emigrierten Salzburger Protestanten, den Georgia Salzburgers. New Ebenezer on the Savannah River (Die Georgia-Salzburger. New Ebenezer am Fluss Savannah) nach.
Die Ausstellung führt über weitere „Kunstgeschichten“ in verschiedene Konflikte in der Welt. „Neuer Krieg – Neue Kunst“ ist auf einem Gemälde aus dem Jahr 1974 von Jörg Immendorff und Felix Droese in der Sammlung des Museums zu lesen. Tatsächlich funktioniert die aktuelle Kunstproduktion aus Krisenregionen in zahlreichen Überblicksschauen der vergangenen Jahre wie ein Arsenal eines auf den Nachschub von neuer Kunst hungrigen Kunstbetriebes. Künstler aus dem Deutschland der Nachkriegszeit wie Anselm Kiefer und Jörg Immendorff gehen in ihren Bildwerken der Vergangenheit ihres Landes nach.
Martha Rosler macht uns in ihrer bekannten Serie mit Fotocollagen Bringing the War Home (1967–72 und 2004–08) deutlich, wie wir Krieg über die Massenmedien täglich ins Wohnzimmer geholt bekommen. In seiner Videoinstallation Klatsassin (2006) führt uns Stan Douglas eine Geschichte ohne Anfang und Ende, dafür aber mit schier endlosen Variationen vor. Elaine Reichek greift in einer Werkserie buchstäblich Ariadnes Faden auf und erkundet diese Geschichte in all ihren widersprüchlichen Phasen und Details in Form von gestickten Bildern. Auch Sanja Ivekovic setzt auf das Wiederaufführen von Geschichte und geschichtlichen Ereignissen, wobei sie sich medialer und performativer Mittel bedient. Alice Creischer und Andreas Siekmann schreiben in ihren großräumigen Installationen eine Geschichte der Wirtschaftsmodelle und der Privatisierung des öffentlichen Raums.
Installationen von Heimrad Bäcker und Ian Hamilton Finlay im Atrium des Rupertinum verbinden Erinnerungsarbeit mit Material und Symbolen; ähnlich inszeniert Renée Green einen Raum im kolonialen Empirestil. Im Rupertinum schließen Harun Farocki, Omer Fast und Walid Raad in ihren Arbeiten mit bild- und medienanalytischen Betrachtungsweisen an. Kader Attia, Lothar Baumgarten, Andrea Geyer, Deimantas Narkevicius, Chen Shaoxiong und Akram Zaatari bedienen sich historischer Archive und Sammlungen, die von ihnen in verschiedenster Weise neu aufgeführt werden. Attia suchte für seine Installation Enteignung (2013) ethnologische Sammlungen in kirchlichen Einrichtungen auf, unter anderem das Missionshaus Maria Sorg in Bergheim bei Salzburg. Anri Sala und Danh Vo (dessen Installation am Mönchsberg zu sehen ist) führen anhand biografischer Kontexte die Vielschichtigkeit der Konstruktion von Geschichte vor. Künstler wie Wael Shawky beleuchten Geschichte aus einem anderen Blickwinkel als dem abendländischen: In Kabarett Kreuzzüge: Die Horrorshow-Akte (2010) stellt er die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber mit den berühmten Lupi-Marionetten ausItalien nach. Gülsün Karamustafa führt uns in ihrer Videoinstallation Memory of a Square (Erinnerung an einen Platz, 2005) durch eine Geschichte des Taksim-Platzes in ihrer Heimatstadt Istanbul.
Die parallel auf dem Mönchsberg gezeigte Werkschau Simone Forti. Mit dem Körper denken: Eine Retrospektive in Bewegung (18. Juli – 9. November 2014) bildet mit den News Animations von Forti die Brücke zur Ausstellung Kunst/Geschichten. Die Künstlerin, Choreografin, Tänzerin und Schriftstellerin Simone Forti befasst sich in ihren News Animations mit der Frage, wie aktuelle Ereignisse im Tanz gespiegelt werden können.
Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung: anonym, Kader Attia, Elias Baeck, Lothar Baumgarten, Alfred Baumgartner, Heimrad Bäcker, Michael Blum, Marcel Broodthaers, Johann August Corvinus, Alice Creischer, Gerti Deutsch, Otto Dix, Stan Douglas, Harun Farocki, Omer Fast, Ian Hamilton Finlay, Simone Forti, Andrea Fraser, Andrea Geyer, Dan Graham, Renée Green, Ernst Haas, Jörg Immendorff / Felix Dröse, Jörg Immendorff, Sanja Ivekovic, Kurt Kaindl, Gülsün Karamustafa, Anselm Kiefer, Käthe Kollwitz, Christoph Lederwasch, Deimantas Narkevicius, Walid Raad / The Atlas Group, Elaine Reichek, Aura Rosenberg, Martha Rosler, Anri Sala, Andreas Siekmann, Wael Shawky, Chen Shaoxiong, Johann Conrad Stapff, Danh Vo, Lawrence Weiner, Akram Zaatari
Museum der Moderne Salzburg
Mönchsberg 32
5020 Salzburg, Austria
T +43 662 842220-403
info@mdmsalzburg.at
museumdermoderne.at
Pressemitteilung